Porto – ein Erbe ganz anderer Art
Von Maralde Meyer-Minnemann
Es war einmal ein pechschwarzer kleiner Kater namens
Pichelim. Er lebte in einer Stadt, die an einem Fluss, aber auch am Meer liegt,
in einem Haus gleich hinter dem Strand bei einer Familie mit vielen Kindern. Pichelim liebte es, sich zu den Anglern auf die
Leuchtturmsmole zu setzen, wo er manchmal einen kleinen Fisch geschenkt bekam.
Er wanderte durch die Gassen des Vororts am Meer, sprang über Gartenmauern in
verwilderte Gärten, wo er sich mit anderen Katzen traf, die weit herumgekommen
waren und ihm von der riesigen, doppelten Brücke erzählten, die über den
Fluss zu den Weinkellern führte, in denen es reichlich Mäuse gab. Und er
begleitete seinen Herrn an den Strand und schaute zu wie der Mann, der aus
Hamburg in diese andere Stadt gekommen war, bis zum Gil Reu, dem weit ihm
Meer liegenden Felsen hinausschwamm. Die Geschichten von Pichelim erzählte unser Vater meinem
Bruder und mir als wir klein waren Sonntagsmorgens im Bett. Wir lagen dann,
jeder in einen Arm geschmiegt da und lauschten gebannt den Abenteuern des
kleinen Katers und stellten uns diese fremde Welt vor. Jahre später bestiegen wir mit unserer Mutter in Antwerpen
ein Schiff, das uns durch die stürmische See der Biskaya (da rollte die
Suppenschüssel quer über den Tisch auf den Kapitän zu – kein Seemannsgarn!
– und ich schaffte es, unter den strengen Blicken der von Rehen und allerlei
Getier umringten Namenspatronin des Schiffes
seekrank gerade noch an Deck. Das Schiff hieß Fauna...) an die Mündung
des Flusses mit dem goldenen Wasser brachte. Dass es golden war, wussten wir von
Pichelim. Damals konnten Schiffe nur bei Flut in den Hafen von Porto
gelangen. So hieß die sagenumwobene Stadt. Als wir ankamen, war Ebbe und wir
wurden, obwohl wir vor Aufregung darüber, die ferne Küste bald von Nahem zu
sehen, knallwach waren, zum Mittagschlaf in die Kajüte geschickt. 1950 fanden Mütter
noch, dass Kinder von nicht ganz Sieben (ich)- und Fünf (mein Bruder) noch
Mittagsschlaf halten mussten. Wir schliefen natürlich nicht, sondern warteten. Irgendwann setzte sich das Schiff in Bewegung. Wir rannten
an Deck. Die Küste kam näher. Da war ein Leuchtturm mit einer langen Mole. Auf
der Mole kleine winkende Gestalten. „Das ist Eure Familie“, erklärte
unserer Mutter. Die Geschwister meines Vaters, ihre Männer bzw. Frauen, Kinder.
Die kleinen Gestalten winkten, rannten stiegen in ein paar Autos, fuhren,
stiegen wieder aus, winkten wieder. Diesmal standen sie zwischen riesigen
Palmen, den ersten Palmen meines Lebens, die am Ufer eine Allee bildeten. Später
lernte ich, dass das der Passeio Alegre war. Ein hübscher Park mit einer
– was ich erst wiederum viele Jahre später feststellte – hinreißenden
Jugendstilbedürfnisanstalt. Auf die Palmenallee folgten kleine Häuser, vor denen Wäsche
an gespannten Leinen flatterte. Die Autos mit den Gestalten, die meine Familie
sein sollten, begleiteten uns am Ufer. Nachdem das Schiff eine weite Kurve
gefahren war, ging es vor einem großen, grauen Gebäude mitten im Strom vor
Anker. Das Fallreep wurde heruntergelassen, eine kleine Barkasse kam, in die die
wenigen Passagiere (die Fauna war ein Frachter der Neptunlinie aus
Bremen, der auch Passagiere mitnahm) und deren Koffer verladen wurden, und das
kleine Schiff tuckerte an Land. In dem großen, grauen Gebäude erwartete uns der erste
einheimische Portugiese meines Lebens (Portugiesen kannte ich durchaus, zum
Beispiel den damaligen Vizekonsul, der mit den Augen rollte und uns dazu „Eu
sou o pirata de perna de pau“ vorsang. Diese Liedzeile ist übrigens der
erste portugiesische Satz, den ich gelernt habe). Der erste einheimische
Portugiese war klein, rund, schnurrbärtig, braungebrannt und trug weiße
Handschuhe, mit denen er unsere Koffer durchwühlte. Vor dem großen, grauen Haus, das, wie mir nun klar war,
das Zollgebäude war, standen die Autos, die uns begleitet hatten und davor die
Gestalten, die gewinkt hatten: die Familie. Ich hatte gar keine Zeit mehr, mich
zu fragen, was ich sagen sollte oder so, denn schon wurde ich von all diesen
wildfremden, herzlichen Leuten geküsst. In den nächsten Tagen lernte ich „die Familie“ kennen.
Als ich kurz darauf Geburtstag hatte, gab es die größte Feier, die ich je
erlebt hatte. Da waren zum einen die tios“, will heißen 5 tias –
Tanten und 5 tios – Onkel. Dazu mindestens 10 primos – Vettern
und Kusinen. Außerdem noch die Freunde der tios mit deren Kindern, die
natürlich alle auch zur Familie gehörten. Und ich lernte Foz kennen, die Welt des kleinen Pichelim.
Meinen Großvater habe ich nie kennengelernt, aber ich stelle mir immer vor, wie
er zum Gil Reu schwimmt. Ob dieser Felsen wirklich so heißt, weiß ich
bis heute nicht. Aber es hörte sich so an. Daß der Ort, an dem ich mich
befand, Foz hieß, habe ich allerdings erst ganz allmählich begriffen (Man sagt
ja einem Kind nicht: Du bist jetzt in Foz.).Als ich zwei Jahre später wieder
dort war, sah ich, daß vorn an den gelben Straßenbahnen mit den merkwürdig
wimmernden Bremsen „FOZ“stand. Ich konnte mittlerweile lesen und kannte
„FOX, die gute Zigarette“ aus den Rororo-Taschenbüchern und fragte mich
lange, ob Foz (gesprochen Fots) auch eine Marke sei, bis irgendwann, in einem
magischen Moment das gelesene „Fots“ mit dem gesprochenen Foz zusammenfiel
und ich begriff, wo ich war, und dass im Portugiesischen ein „z“ nach einem
Vokal wie ein leichtes, feines, stimmhaftes „sch“ gesprochen wird. Im Laufe der Jahre und der vielen Male, die ich in Porto
bei meiner Familie war, lernte ich nicht nur Portugiesisch, sondern auch, was
sich alles nicht gehörte (fica mal). Zum Beispiel einfach allein in die Stadt gehen und auf den
Turm der Clérigos-Kirche steigen. Oder durch die Altstadt spazieren (que
horror!!!). Und ich lernte, was für eine vertrackt komplizierte Sache der namoro
ist. Dass eine meiner Kusinen erst vom vielen Sitzen auf der Steintreppe
vor dem Haus eine Blasenentzündung bekommen musste, bevor ihr zukünftiger
Ehemann, das Haus ihrer Eltern betreten durfte. Hin und wieder musste ich meine
Kusinen als arame farpado, Stacheldraht, begleiten, wenn sie abends mit
ihren Freunden auf der Avenida spazieren gehen wollten, auf der so viele
Leute unterwegs waren, dass kaum etwas „passieren“ konnte. Wahrscheinlich
sollte ich verhindern, dass sie sich am Strand verkrümelten. Sie versuchten es
nicht einmal. Sie reihten sich ein und marschierten züchtig erst in die eine
Richtung und dann in die andere. Ich folgte in diskretem Abstand und schaute mir
die Leute an. Die Jungs, den Pullover über der Schulter, die Mädchen
im braven Kleid mit Petticoat (es handelt sich um die 50er). Die ältere
Generation: die Damen im ewigen Hemdblusenkleid mit Kette und Ohrringen, von den
Herren mit festen Griff am Ellenbogen geleitet. So machte es auch mein Onkel
Ramiro, wenn er, meine Tante Elvira mit der einen und mich mit der anderen Hand
gepackt, mit uns ins Kino ging. Ins Coliseu zum Beispiel. Richtig aufgerüscht.
Erste Versuche mit make-up. Und dann die Pause, in der alle wie auf der
Avenida im Foyer kreisten und jeder jeden anguckte. Hinterher ging es auf
ein Bierchen (für den Onkel) zu CUF. Das Coliseu ist nach langen Jahren des
Verfalls heute zum Glück restauriert, der Veranstaltungsort für Konzerte und
andere Events. Die CUF gibt es nicht mehr. Dort sind Luxuswohnungen
entstanden. Auch die Avenida ist nicht mehr, was sie einmal war. Die
zweistöckigen Häuser sind Hochhäusern gewichen. Foz
sieht von See wie ein kleines Copacabana aus. Die Jungs tragen zwar immer
noch den Pullover um die Schultern gelegt und vor dem Hals an den Ärmeln
zusammengeknotet. Die Mädchen aber gehen locker in Jeans und müssen Gott sei
Dank nicht mehr mit ihren Freunden auf der Steintreppe vor dem Haus hocken. Man
fährt inline-skates wie sonstwo in Europa. Aber die alten Herrschaften
gibt es noch: Ihn im Anzug und sie im Hemdblusenkleid. Und sie gehen immer noch,
abends einmal die Avenida hinauf bis zum Molhe und dann wieder zurück.
Das alte Café ist ein Pizzaladen, aber dafür gibt es viele neue Cafés direkt
am Strand. Wenn ich einmal im Jahr in Porto bin – aus
beruflichen Gründen muss ich etwa einmal im Jahr nach Lissabon fahren und nutze
immer die Gelegenheit, eine Herzensreise nach Porto zu meinem Bruder zu machen
(für ihn war unsere erste Reise nach Portugal die Reise an seinen zukünftigen
Wohnsitz), setze ich mich in die Straßenbahn der Linie 1 (die, auf der FOZ
steht ) und fahre am Douro entlang in die Stadt. Dann komme ich am großen,
grauen Haus vorbei, das heute ein Kongress- und Ausstellungszentrum ist. Steige
bei der Igreja de São Francisco aus, in der ich nur einmal war, weil ich
weiß, daß ich nie wieder erleben werde, wie in der damals noch nicht
restaurierten, düsteren Kirche durch ein Fenster das Sonnenlicht auf einen Teil
der vergoldeten Holzschnitzerei fiel und sie zum Leuchten brachte. Freue mich,
dass der Mercado Borges noch steht, und dass es den Korkladen noch immer
gibt und denke an den Gitarrenmacher nebenan, bei dem mein Bruder vor vielen
Jahren Unterricht nahm. Ich wandere die Rua Mouzinho da Silveira zum
Bahnhof São Bento hinauf, gehe in die Halle, betrachte die Azulejos
und erinnere mich daran, wie wir, mein Bruder und ich, dort vor vielen Jahren,
allein (ich war damals zwölf – und die Familie schlug die Hände über dem
Kopf zusammen) die Eisenbahn nach Régua genommen haben, weil mein Vater fand,
wir sollten mal sehen, wo der Portwein wächst. Die großen Cafés an der Avenida dos Aliados
sind Autosalons geworden, das letzte zur Hälfte ein MCDonald`s. Die Brasileira
war das letzte Mal geschlossen, davor gab es dort ein
Selbstbedienungsrestaurant. Aber das Majestic gibt es noch. Da sitze ich
nostalgisch und trinke meinen Kaffee, bevor ich die Rua da Santa Catarina
nicht zum neuen Einkaufszentrum hinauf wandere, sondern vorher zum Bulhão-Markt
abbiege. Dort schlafen die Katzen noch auf den Schindeldächern, hängt beim
Schlachter ein trauriger Schweinskopf neben einem traurigen Kruzifix. Gegenüber lag einst die Confeitaria von Tio
Ramiro, in deren hinteren Büroräumen vor Jahrzehnten die Buchhalter mit Alpakaärmelschonern
an Stehpulten standen... Jetzt ist da ein Supermarkt. Unten an der Praça da
Liberdade, gleich neben den Bushaltestellen, gibt es aber noch zwei von
diesen alten Confeitarias. Dort setze ich mich hinein, um einen Jesuita
zu genießen. Die Madams in den Hemdblusenkleidern sind auch da. Oder in den
etwas zu kurzen, etwas zu engen Röcken.. Zurück nehme ich meist den Bus bis zum Passeio
Alegre. Dann wandere ich unter den Palmen am Fluss entlang, schaue den Anglern
zu. Manchmal schleicht dort ein kleiner, pechschwarzer Kater herum. Ein
Nachfahre von Pichelim?

|
| Portugal-Post Nr. 14 / 2001 |
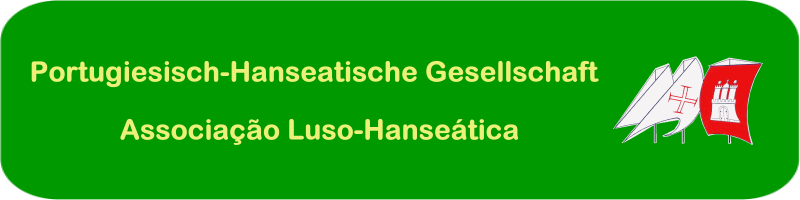 .
.