Von der Freiheit, eigene Fehler machen zu dürfen
Mosambik - 30 Jahre Unabhängigkeit
Von Elísio Macamo*
In 30 Jahren Unabhängigkeit bin nicht nur ich älter geworden, sondern auch der Traum, der mutige Frauen und Männer in Mosambik dazu geführt hat, für ihre Rechte zu kämpfen. Ich erinnere mich an die Unabhängigkeit, als ob sie gestern gewesen wäre. Am 22. Juni 1975 durfte ich vor jubelnden Menschen in Xai-Xai, der Provinzhauptstadt von Gaza, Samora Machel ein Baströckchen reichen. Er war frisch aus dem Befreiungskampf gekommen und befand sich auf seiner historischen Reise durch das Land: do Rovuma ao Maputo, hieß es. Er hielt in allen Provinzhauptstädten an und ließ sich von den Mengen für die erlangte Freiheit feiern. Ich weiß immer noch nicht, warum ich ausgewählt wurde, um ihm das Geschenk der Bevölkerung von Xai-Xai zu geben. Aber es war ein Moment, den ich nie vergessen werde, zumal ich sein bärtiges Gesicht küssen musste! Ich fand es angenehmer, Marcelino dos Santos auf die Backe zu küssen: Er war rasiert.
Ich war viel zu jung, um die genaue Bedeutung des Anlasses zu wissen. Dass es sich um einen besonderen Moment in der Geschichte des Landes handelte, war mir klar. Man sah das in den Gesichtern der Eltern, Nachbarn und fremden Leute. Man durfte auch die Schule schwänzen. Ich wusste, dass sich vieles verändern würde. Alle in Xai-Xai waren froh darüber, dass "Kwekwere", ein portugiesischer Polizist, der Angst und Terror verbreitete, gehen würde. Ich erinnere mich immer noch daran, wie er einen Cousin von mir verhaftete, weil er ihn abends in der Stadt ohne Ausweis ertappt hatte. Mein Vater nahm mich mit, als er zu "Kwekwere" ging, um ihn um die Befreiung meines Cousins zu bitten. Ich werde die Demütigung meines Vaters nie vergessen. Ich war noch sehr klein, aber ich konnte die richtigen Verhältnisse verstehen: Mein Vater war schwarz und der Polizist war weiß; mein Vater war ein Eingeborener und der Polizist ein Portugiese; mein Vater war Untertan und der Polizist die Macht.
Ich gehöre einer Generation in Afrika an, die sich glücklich schätzen kann: Wir leben in Freiheit, haben aber die Kolonialherrschaft noch gekannt. Wir wissen, wie kostbar die Freiheit ist. Wir wissen, was es bedeutet, ein Bürger zweiter Klasse zu sein. Wir haben die Erfahrung gemacht, Mitschüler zu haben, die weniger wussten als wir, aber von den Lehrern aufgrund ihrer Hautfarbe bevorzugt wurden; Mitschüler, auf die das Bildungssystem zugeschnitten war: Sie lernten in einer Sprache, die sie zu Hause mit den Eltern sprachen; sie lasen Gedichte, die von Dingen handelten, die ihnen vertraut waren: Könige, Schnee und Walzer; Mitschüler, die Kinder von Eltern waren, die, um als Menschen akzeptiert zu werden, nicht beweisen mussten, dass sie Portugiesisch sprechen konnten, Christen waren, am Tisch mit Messer und Gabel aßen oder gar mit den eigenen Kindern eine Sprache sprachen, die nicht ihre war.
Ich weiß auch aus persönlicher Erfahrung, wie schwer der Kampf um die Unabhängigkeit war. Mein Onkel verbrachte 8 Jahre seiner Jugend als politischer Gefangener in Haft. Die südafrikanische Polizei nahm ihn fest, als er zum dritten Mal versuchte, sich den Befreiungskämpfern in Tansania anzuschließen. Er hatte Pech. Er gehörte zu einer größeren Gruppe, die sich in drei aufgeteilt hatte. Samora Machel war in der ersten Gruppe. Mein Onkel sowie der jetzige Botschafter Mosambiks in Berlin, António Sumbana, waren in der dritten Gruppe. Von ihr landeten alle im berühmt berüchtigten Machava-Gefängnis. Acht Jahre lang. Da ich meinem Onkel ähnlich sah, bestand mein Beitrag zum Unabhängigkeitskampf Mosambiks darin, versteckt zu werden, wann immer die Oma zu Besuch kam: Der Anblick schmerzte sie zu sehr.
Meine Generation hat die Unabhängigkeit gefeiert. Meine Generation hat die Hoffnung gespürt, die wir alle damit verbunden haben. Wir haben tatsächlich geglaubt, dass wir für eine Mission bestimmt waren: Mosambik richtig zu befreien, d.h. nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich und kulturell. Dem Volk seinen Stolz zurückbringen. Die Menschen an den Wundern der Zivilisation teilhaben lassen. Afrika befreien, vor allem aber Südafrika, Simbabwe und Namibia. Ich habe daran geglaubt und habe mit Überzeugung revolutionäre Lieder gesungen. Vom Marxismus habe ich wenig verstanden, aber weil man damit über unsere Freiheit, Stolz und Zukunft sprechen konnte, hatte ich wenig einzuwenden.
Den Renamo-Krieg werde ich nie verstehen. Die Notwendigkeit der Versöhnung zwingt mich dazu, über manche Dinge hinweg zu sehen. Ich bin gerade aus Mosambik zurückgekehrt. Ich habe dort mit ehemaligen Kriegsflüchtlingen gesprochen. Sie haben mir von ihrer Kriegserfahrung erzählt. Auch mehr als 10 Jahre danach schütteln sie den Kopf aus Unverständnis, sie verstehen nicht, warum sie für die Entscheidungen anderer leiden mussten. Sie können es nicht begreifen, warum der sogenannte Kampf um die Demokratie auf die Verachtung von Leben angewiesen sein musste. Ich schüttele auch den Kopf über die Zeit, die Energie und die Ressourcen, die wir leichtfertig vergeudet haben.
Heute müssen wir bei Null anfangen: es geht wieder um die politische, wirtschaftliche und kulturelle Unabhängigkeit. 30 Jahre danach. Politisch müssen wir uns gegen externe Kräfte behaupten. Es ist wie damals, als die Portugiesen kamen. Sie wollten uns zivilisieren; die Neuen wollen uns entwickeln. Klingt gleich. Anders als früher will uns heute niemand ausbeuten. Wir bestimmen nicht über unsere Ressourcen, wir können sie nicht einmal ausbeuten. Wir sind auf andere angewiesen, die das Geld und das Wissen dazu haben. Und schließlich, wir sind immer noch auf der Suche nach einer echten nationalen Identität, was auch immer das sein mag. Was heißt, Mosambikaner zu sein? Wenn drei Leute jeweils aus dem Norden, Zentrum und Süden sich treffen, treffen sich drei Mosambikaner?
Irgendwie sind wir selbst schuld daran, dass wir aus 30 Jahren Unabhängigkeit wenig gemacht haben. Und dem Anschein nach haben wir noch immer nicht angefangen. Vielen von uns fehlt der Mut, dies zuzugeben. Es könnte daran liegen, dass einige, die diese Schuld auf uns schieben, stillschweigend der festen Überzeugung sind, dass wir der Unabhängigkeit nicht würdig sind. Umso wichtiger ist es, die 30 Jahre zu feiern, die uns geschenkt worden sind, um eigene Fehler zu machen.

|
| Portugal-Post Nr. 34 / 2006 |
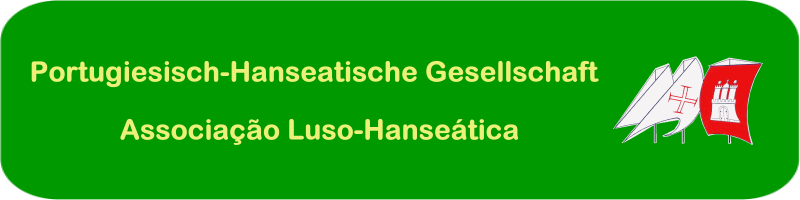 .
.